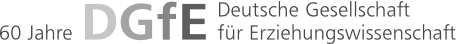- DE |
- EN
Weitere Arbeitsgruppen
Digitale Veranstaltungsreihe „Forum SGB VIII inklusiv“
Während ein großer Teil des neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) am 10. Juni 2021 in Kraft getreten ist, steht die sogenannte Gesamtzuständigkeit – in Abhängigkeit eines noch zu verabschiedenden Bundesgesetzes – erst im Jahr 2028 an. Sowohl die nun fachlich umzusetzenden Bestimmungen als auch die zukünftig zu erwartenden Änderungen bieten gute Gründe, den Prozess weiterhin wissenschaftlich wie fachpolitisch zu begleiten und zu kommentieren.
In Fortsetzung und Neujustierung der Arbeitsgruppe SGB-VIII-Reform in der DGfE-Kommission Sozialpädagogik wurde ein digitales Forum ins Leben gerufen, das die o. g. Notwendigkeit des Austauschs und der Verständigung aufgreift. Unter dem Label „Forum SGB VIII inklusiv“ wurden unterschiedliche, die Herausforderungen der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe betreffende wissenschaftliche Beiträge diskutiert, die von Kolleg:innen an verschiedenen Standorten verantwortet wurden und sich an Personen aus Wissenschaft, Studium, Politik, Fachverbandsarbeit, örtlicher Praxis und interessierter Öffentlichkeit richteten. In der vorliegenden Dokumentation (hier) (dort werden die zentralen Inhalte der fünf Fachforen dargelegt, die im Rahmen der digitalen Veranstaltungsreihe „Forum SGB VIII inklusiv“ der DGfE-Kommission Sozialpädagogik zwischen 04/2023 und 06/2023 durchgeführt worden sind. Es wird ein kurzer Überblick über die jeweiligen Inhalte gegeben und auf (1) die Bedeutung für die Fachwissenschaft, (2) die Bedeutung für Studium/Ausbildung und (3) die Bedeutung für die fachpolitische Diskussion eingegangen.
AG staatliche Anerkennung
Weitere Informationen folgen.
AG Aufarbeitung
Weitere Informationen folgen.
Forum Dem_fei_recht (gemeinsam mit DGSA)
Weitere Informationen folgen.